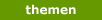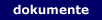» aktuelles/Gegen den Strom – 10 Gründe in Deutschland zu forschen
dieser Text ist archiviert. Enthaltene Aussagen und Angaben können inzwischen veraltet oder falsch sein.
Bitte beachte deshalb das Erstellungsdatum (unten auf der Seite). Falls sich zum Thema kein neuerer Text findet, erkundige Dich bitte per E-Mail (AStA-Adresse links) bevor Du Dich auf diese Angaben verlässt.
In Amerika ist alles besser. Oder doch nicht? Trotz des gepflegten deutschen Jammerns über den „Abfluss der Gehirne“, den „brain drain“, suchen einige Wissenschaftler den umgekehrten Weg – und kehren zurück aus dem gelobten Forschungsausland. Aber warum nur? Wir fragten mehr als ein Dutzend Rückkehrer nach ganz alltäglichen Vorteilen eines Forscherlebens in Deutschland.
Der Weg zur Arbeit
Ein gutes Forscherleben lebt zuallererst von lebenden Forschern – jedenfalls von solchen, die heil an ihrem Arbeitsplatz ankommen. In den USA war das für manche nicht immer selbstverständlich: Ein Rückkehrer freut sich, dass er „in Deutschland wieder mit dem Rad fahren kann, ohne sich gleich als Selbstmordkandidat zu fühlen“. Ein anderer betont, dass junge Frauen in Deutschland auch nachts noch sicher mit der U-Bahn fahren können. „Und nirgends“, sagt ein Dritter, „werden so viele Leute erschossen wie in den USA.“ Doch egal wie groß die Gefahren wirklich sind: Die amerikanische Autofahrerei nervt viele, und das deutsche Gefühl der Sicherheit ist für einige im Auslands-Alltag keine Selbstverständlichkeit gewesen – ein kleiner Pluspunkt für Deutschland.
Die Grundausstattung
Heil am Arbeitsplatz angekommen, erlebt so mancher Neuling im Forschungs-Mekka jenseits des Atlantiks weitere Unannehmlichkeiten: Das Mekka besteht anfangs oft nur aus einem Zimmer und einem PC. Alles andere muss über Drittmittel eingeworben werden, sagt Dieter Rombach, heute am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software-Engineering in Kaiserslautern: „Da kann man sich leicht verzetteln.“ Zwar wird besonders begehrten Neuankömmlingen auch mal ein schönes „Start-up-Päckchen” geschnürt. Doch bereits der Techniker fürs Labor gehört selten zur Infrastruktur eines Instituts, sondern muss extra finanziert werden. „In den USA zahlen Sie für jede Briefmarke – sogar wenn Sie Nobelpreisträger sind“, so Helmut Schwarz, der als Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) viel mit Rückkehrern zu tun hat.
„Wir haben hier nach wie vor eine tolle Grundausstattung, schon an kleinen Universitäten“, sagt auch Sebastian Braun, der nach Aufenthalten in England und Frankreich in Paderborn arbeitet. Vielleicht lebten Sozialwissenschaftler wie er in anderen Welten als Naturwissenschaftler. Aber während die Computer-Standleitung hier normal sei, teilten sich Professoren in Frankreich oft mit ein oder zwei Kollegen das Zimmer: „Arbeitsbedingungen, wie wir sie hier für studentische Hilfskräfte kennen.“
Brot, Bier- und andere Preise
Auch Wissenschaftler müssen essen. Und wie bei der Forschung geht es auch hier schnell ums Geld. Abstoßend, sagen einige, seien die mitunter horrenden Preise für Miete und Nahrungsmittel im Ausland: „Wenn man nur ein Bier trinken geht und anfängt, auf die Zahl zu gucken, was das wieder kostet – das ist ein weiches Standortkriterium, das auf die Nerven gehen kann.”
Viele andere berichten von kulinarischen Heimweh-Anfällen: „Irgendwann vermisst man gute Wurst und guten Käse“, sagt Gerhard Hilt, heute an der Universität Marburg. „Irgendwann sind Sie weich gekocht – dann bezahlen Sie jeden Preis.“ Was Brot angeht, erwies sich nicht einmal selber backen als Ausweg im Ausland. „In der Backmischung war wohl zu viel Natriumcarbonat drin“, hat der Chemiker analysiert. Die Folge: Auch im eigenen Ofen trieb das Brot zu sehr – und glich schließlich der vom US-Bäcker bekannten Luftnummer.
Der Studentenpool
Ein so möglicherweise um etliche Dollar erleichterter Forscher, der vom Essen in sein Büro zurückkehrt, muss sich dort um die nächste Frage kümmern: Wen stellt er als Mitarbeiter ein? Pluspunkt für Deutschland, sagt DFG-Vizepräsident Harald Schwarz. Die Qualifikation nach dem deutschen Diplom sei „um Nummern besser“ als nach dem Master-Abschluss im Ausland: „In diesem Pool von Studenten sind genug Köpfe, nach denen ein Rückkehrer fischen kann.“ Und während im Ausland so mancher Student erst mit der Doktorarbeit „richtig“ ins Labor komme, habe der Nachwuchs hier zu Lande besser gelernt, praktisch und selbstständig zu arbeiten.
Warum aber sollte ein neugekürter deutscher Chef nicht auch von den USA aus im deutschen Diplom-Pool fischen? Dem stehen offenbar leicht so lästige Dinge wie eine Arbeits-Erlaubnis im Weg – was schon zum nächsten Punkt führt.
Die Politik
„Die Vereinigten Staaten begrüßen die internationale Forschergemeinde zur Jahreskonferenz. Wissenschaftler aus Pakistan, Irak und Nord-Korea müssen leider draußen bleiben.“ – Solche Sätze, die klingen wie aus einem schlechten Film über die McCarthy-Ära, sind Realität. „In den USA können sie für Konferenzen Experten aus manchen Ländern nicht mehr einladen“, sagt Fraunhofer-Forscher Rombach. „Die bekommen keine Visa.“ Die Sicherheitspolitik des US-Homeland Security Office nehme seit den Anschlägen des 11. September absurde Züge an. Auch der Irak-Krieg und die sonstige Bush-Politik schreckt besonders junge Deutsche ab. „Die Offenheit, der man sich in den USA gerühmt hat, ist in Gefahr“, sagt Rombach.
„Spielgeld“ für Visionen
„Forschung braucht Spielgeld. Und Zeit – ohne Druck, alle drei Monate etwas abzuliefern oder Anträge schreiben zu müssen.“ Das Spielgeld, wie es ein Rückkehrer nennt, scheint oft leichter in Euro gezahlt zu werden als in Dollar. Zwar kommt die kurzfristige Förderung in den USA besser weg („flexibler und mehr Freiheit für Kreativität“). Doch Deutschland gilt bei vielen als Land mit „mehr Platz für langfristige Visionen“. Grundlagenforschung werde weniger an die kurze Leine genommen. In Amerika stehe man dagegen oft vor der Wahl: Geld einwerben oder forschen.
„Sobald ein Thema nicht mehr en vogue ist, muss man sich in den USA neu orientieren“, sagt Peter Gumbsch vom Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik in Freiburg. In Deutschland habe man eher Sicherheit, etwas noch zur Industriereife entwickeln zu können, auch wenn die Bedingungen für das Forschungsfeld schlechter werden. Zudem, so ein Kollege, sei man in den USA oft abhängig von einem einzigen Geldgeber.
Für Kai Uwe Hinrichs vom DFG-Forschungszentrum Ozeanränder in Bremen hat eine feste Professorenstelle in Deutschland daher immer noch „magische Anziehungskraft“: „Dass einer sagt ,Wir glauben an Dich‘ und Dir den Vertrauensvorschuss gibt, ist eine tolle Sache.“ Und vor allem Max-Planck-Direktoren betonen: Die Forschungsbedingungen hier, in denen man langfristig planen kann, seien „einmalig in der Welt“.
Kultur, Kinder und Soziales
Trotz Pisa: Wenn es um die Schulbildung der Kinder geht, bevorzugen viele das eigene Land. Schon die „grottenschlechte“ Qualität des Fernsehens, sagt ein Forscher, sei symptomatisch für das Bildungsniveau vieler Amerikaner. So mancher hat sich zu seiner US-Zeit die Tagesschau aus dem Internet geholt: „Da mussten wir nicht hören, dass in Milwaukee ein Sack Reis umgefallen ist.”
Das Bildungswesen, das kulturelle Angebot, das soziale Netz – all das genießt bei den Rückkehrern in Deutschland ein höheres Ansehen: „Bei manchen US-Kollegen war es allein ein irrer Akt, bis sie überhaupt mal zum Arzt gehen konnten – da nicht klar war, wer die Behandlung bezahlen würde.“
Die Vernetzung
„Vielleicht“, sagt Simon White vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching, „vielleicht ist es wie mit der EU: Die Forscher in Europa haben gelernt, miteinander zu arbeiten, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt.“ White ist Brite, kein echter „Rückkehrer“ also, aber er kennt beide Systeme gut. Die größere Konkurrenz in den USA behindere die Kooperation, aus Angst vor Ideenklau etwa. „Und es fällt dort schwerer, über Schwachstellen in der eigenen Arbeit zu reden.“
Auch andere sehen in Deutschland die bessere Vernetzung: „Sonderforschungsbereiche“ oder „Schwerpunktprogramme, in denen verschiedene Forschergruppen über Jahre zusammenwachsen – „das gibt es in den USA so nicht“, sagt Regine Kahmann vom Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg. „Dort kann jeder Einzelne nur sein persönliches Netzwerk spinnen.“
Der enorme Druck für den Einzelnen hat nach Ansicht eines Rückkehrers sogar gravierende Folgen: „In den USA wird mehr geschummelt.“ Das Fälschen von Forschungsergebnissen sei wohl noch häufiger als in Deutschland.
Der Sonntagsspaziergang
„Aha, Deutscher”. Für Gerhard Hilts US-Kollegen war die Sache bei der Frage nach Spazierwegen klar. Die Antwort klang dann fast verlegen. „Ähem, das ist hier etwas schwieriger.“ Nicht dass es in der Gegend um die Princeton University an schönen Ecken mangelte. Doch wenn Wissenschaftler und andere Normalsterbliche nach ihrem harten Arbeitsalltag Erholung in der Natur suchen, so ist die oft schlicht nicht zugänglich: Privatbesitz – Betreten verboten. „Alles, was schön ist, war privat“, klagt auch ein anderer Rückkehrer von der Ostküste.
Ob in den Wäldern um Princeton oder an den Stränden: Sich in der Freizeit frei bewegen zu können, nennen viele als „weichen“ Standortvorteil für Deutschland. Aber würde jemand ernsthaft wegen der Qualität des Sonntagsspaziergangs zurückkehren? Sicher nicht. Dennoch, sagt Regine Kahmann: „Es sind auch die vielen kleinen Dinge, die im Alltag zum Wohlfühlen wichtig sind.“
Der Trotz
Und die Nachteile? Etwa die geringere Flexibilität in Deutschland? Oder das lange Warten junger Forscher, bis endlich eine Professorenstelle frei wird? So mancher Befragte fragt zurück: „Zehn Gründe in Deutschland zu forschen – gibt es überhaupt so viele?“
Doch über die Nachteile ist schon viel geschrieben worden. Fraunhofer-Forscher Rombach empfiehlt daher folgende Faustregel: „In den USA ist es nie ganz so gut, wie es dargestellt wird, in Deutschland nie ganz so schlecht.“ Und für Gerd Kempermann, ein Rückkehrer, der heute am Max-Delbrück-Centrum in Berlin arbeitet, können Nachteile sogar ein Ansporn sein: „Es war auch so eine Art Trotz: Kann doch nicht sein, das wir das hier nicht hinkriegen!”
Quelle:
Süddeutsche Zeitung vom 5./6. 1. 2004
Autor: Holger Wormer
Peer Jürgens [8. Januar 2004]
« zurück zur letzen Seite | zum Seitenanfang